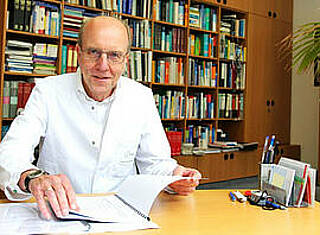Gesundheitsstadt Berlin zieht Zwischenfazit zur Corona-Pandemie: „Müssen vorsichtig und demütig bleiben”

Experten beim Live-Talk über die Corona-Pandemie: Deutschland ist bisher mit einem blauen Auge davon gekommen, die ökonomischen Folgen der Krise sind aber im Gesundheitswesen jetzt schon spürbar (Im Bild: Ulrike Elsner (l) und Dr. Andrea Grebe)
Knapp 200.000 nachgewiesene Infektionen, rund 9.000 Todesfälle, aktuell nicht mehr als 500 Neuinfektionen pro Tag - bei über 83 Millionen Einwohnern: Sieht man von der traurigen Tatsache ab, dass jeder Corona-Verstorbene einer zu viel ist, hat Deutschland in der Corona-Pandemie vieles richtig gemacht. Vor allem war das Gesundheitssystem zu keinem Zeitpunkt überlastet. „Noch nie habe ich so oft gehört: ‚Ich bin so froh in Deutschland zu sein‘“, eröffnete Dr. Franz Dormann, Geschäftsführer von Gesundheitsstadt Berlin, den Live-Talk am Dienstagabend, bei dem namhafte Vertreter des Gesundheitswesens ein Zwischenfazit zur Bewältigung der Corona-Pandemie zogen.
Überraschend starker Zusammenhalt
Und das fiel überwiegend positiv aus. Neben dem außerordentlichen Einsatz des medizinischen Personals wurde insbesondere ein ressortübergreifender Zusammenhalt gelobt. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus war nach eigenen Angaben „positiv überrascht“, wie alle in einer noch nie dagewesenen Krise plötzlich an einem Strang gezogen haben - Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Spitzenverbände der Krankenkassen und so weiter. Wie man gemeinsam nach Lösungen gesucht habe und weiterhin versuche, aus der Krise zu lernen, um es beim nächsten Mal besser zu machen. „Das zeigt für mich, wenn wir Dinge im System verändern wollen, dann können wir das auch“, sagte der Staatssekretär.
Es gab grobe Fehleinschätzungen am Anfang
Dabei war der Start in die Krise äußerst holprig. Viel zu lange schätzten renommierte Experten das Coronavirus nicht gefährlicher ein als eine normale Grippe, Großveranstaltungen wurden erst verboten und Schulen flächendeckend geschlossen, als die Infektionszahlen bereits exponentielles Wachstum erreicht hatten. Und dann fehlte es wochenlang an der nötigen Schutzausrüstung, die man zunächst aus deutschen Lagern tonnenweise nach China schickte, weil das Robert Koch-Institut noch Mitte Januar glaubte, das Virus werde sich nicht bis nach Europa ausbreiten.
Fachleuten wie Prof. Norbert Suttorp war allerdings zu diesem Zeitpunkt schon klar, was sich da in China tatsächlich zusammenbraute: „Es war klar, dass wir es mit einem Virus zu tun haben, dass sich zweimal um die Welt fressen wird, bis wir ein Medikament oder einen Impfstoff haben“, sagte der Direktor der Medizinischen Klinik Infektiologie und Pneumologie der Charité am Dienstag beim Live-Talk von Gesundheitsstadt Berlin. Unklar sei nur gewesen, wie hart die Pandemie werde.
Deutschland hat ein gute Portion Glück gehabt
Dass die Corona-Pandemie hierzulande bislang weniger hart ausgefallen ist, als in vielen anderen Ländern, hat unterschiedliche Gründe. Da war der zeitliche Vorsprung gegenüber Italien und Frankreich, den Deutschland nutzen konnte, um Test- und Intensivkapazitäten hochzufahren. Da war der glückliche Umstand, dass sich anfangs hauptsächlich die jungen, gesunden (Ski-) Urlauber infizierten. Und letztlich verfügt Deutschland über ein sehr leistungsfähiges Gesundheitssystem, das sich in der Krise von seiner starken Seite zeigte.
„Es sind viele Faktoren, warum Deutschland bisher so glimpflich davon gekommen ist, es gibt nicht den einen Grund“, sagte Dr. Andrea Grebe, Vorsitzende der Geschäftsführung der Vivantes-Kliniken. „Darum müssen wir vorsichtig und demütig bleiben.“
Noch keine Impfung, aber ein Gamechanger bei den Medikamenten
Vorsicht und Demut sind auch deshalb wichtig, weil das Virus nicht an Gefährlichkeit verloren hat und es noch keinen Impfstoff gibt. Ansagen des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech, bis Ende des Jahres könnten 100 Millionen Impfstoffdosen seines RNA-Vakzines zur Verfügung stehen, hält Experte Suttorp für „sehr mutig.“ „Wenn Sie fragen, wann es so weit ist, werden Sie niemanden finden, der das im Moment seriös beantworten kann“, sagte der Pneumologe und Infektiologe.
Anders sieht es bei Medikamenten gegen COVID-19 aus. Mit Dexamethason gibt es laut WHO jetzt einen "lebensrettenden großen klinischen Fortschritt.“ Nach den Ergebnissen britischer Forscher kann das altbekannte Kortison-Präparat die Sterblichkeit von schwerstkranken Covid-19-Patienten um 30 Prozent senken. Die größte Verbesserung im Krankheitsverlauf fanden die Wissenschaftler bei Patienten, die künstlich beatmet werden mussten. Ein weiteres Mittel, das soeben von der EU für bestimmte COVID-19-Patienten zugelassen wurde, ist das Ebola-Medikament Remdesivir. Nach Einschätzung von Professor Suttorp bringt es aber nicht so viel PS auf die Straße wie Dexamethason, das dazu noch viel preisgünstiger und weltweit verfügbar ist. „Dexamethason ist ein echter Gamechanger“, so Suttorp.
Ärzte haben viel über COVID-19 gelernt
In den vergangenen Monaten hat die Wissenschaft viel über die neue Krankheit COVID-19 gelernt. In Berlin hat man zum Beispiel herausgefunden, dass das Virus unser Immunsystem „missbraucht“, um immer mehr Andockstellen an unseren Zellen für sich selber zu produzieren.
Aber auch andere haben ihre Hausaufgaben gemacht. Plötzlich ging vieles, was vorher nicht ging: In wenigen Wochen wurde ein Register aufgebaut, das einen Überblick über die freien Intensivbetten im Lande gibt, erstmals eine Schnittstelle zwischen Laboren und den Gesundheitsämtern und dem RKI geschaffen, Video-Sprechstunden eingerichtet, elektronische Rezepte erlaubt sowie eine Corona-Warn-App entwickelt.
Aufwind für die Digitalisierung erhofft
Mit aktuell 15,2 Millionen Downloads wurde die App laut Christian Klose doppelt so oft heruntergeladen wie alle anderen angebotenen Corona-Apps in Europa zusammen. „Wir sehen in der Krise, was Digitalisierung leisten kann“, sagte der ständige Verteter der Abteilung für Digitalisierung und Innovation des Bundesministeriums für Gesundheit. Jetzt gehe es darum, die guten Dinge in Post-Corona-Zeiten hinüberzuretten und zu verstetigen, sei es die Telemedizin oder das zur Verfügung stellen von Daten für die Forschung. „Technik ist zwar nur Mittel zum Zweck“, sagte Klose, „aber sie kann die Gesundheitsversorgung deutlich verbessern.“
Könnte die Krise also ein Schrittmacher für die Digitalisierung des Gesundheitssystems sein? Christian Klose glaubt ja und auch Andreas Westerfellhaus hofft auf den digitalen Schub, der zum Beispiel Pflegekräfte bei der Bürokratie entlasten würde oder Pflegeeinrichtungen mit Krankenhäusern telemedizinisch verbinden könnte, so dass Pflegebedürftigen die oft überflüssige Fahrt zur Rettungsstelle erspart bliebe. „Wir brauchen jetzt auch einen Digitalpakt Pflege“, sagte er in Anspielung auf den Digitalpakt Krankenhaus, für den der Bund drei Milliarden in die Hand nimmt, um Krankenhäuser digital aufzurüsten.
Kliniken rutschen durch Corona in die roten Zahlen
Die Krankenhäuser kämpfen derweil teils mit enormen Verlusten: Betten mussten für Coronapatienten freigehalten und Eingriffe verschoben werden, hinzukommen Kosten für zusätzliche Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Die Charité zum Beispiel meldet ein Defizit von 75 Millionen Euro in diesem Jahr. Zwar bekommen Kliniken eine Freihaltepauschale von den Kassen, doch die deckt meist nicht die laufenden Kosten. „Es werden viele Kliniken in die roten Zahlen rutschen“, prophezeite Vivantes-Chefin Andrea Grebe. Auch nächstes Jahr sei ein Regelebetrieb nicht möglich wie vor Corona - wegen der Hygiene-und Abstandsregeln. „Wir rechnen mit zehn Prozent weniger Auslastung.“
Für Krankenkassen wird 2021 ein schwieriges Jahr
Die gesetzlichen Krankenkassen haben ähnliche Probleme. Einnahmeverluste durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und Firmenpleiten werden momentan noch von den Liquiditätsreserven des Gesundheitsfonds zwischenfinanziert. Laut der Vorstandsvorsitzenden des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) Ulrike Elsner werden die rückläufigen Einnahmen die Kassen aber im nächsten Jahr stark belasten. Hinzukommen vermutlich Mehrausgaben durch Corona, die noch berechnet werden müssen, und die Erwartung, dass viele verschoben Eingriffe und Arztbesuche nun nachgeholt werden. Im Herbst soll es einen ersten Kassensturz und Gespräche mit dem Finanzminister geben. Die endgültige Bilanz liege noch nicht vor, sagte Elsner, aber sicher sei schon jetzt: „2021 wird ein ganz schwieriges Jahr.“
Deswegen erteilte sie der Forderung, die Kassen sollten sich künftig an den Ausgaben für den seit Jahren kaputt gesparten, aber in der Krise so wichtig gewordenen öffentlichen Gesundheitsdienst beteiligen, eine klare Absage. Öffentliche Aufgaben müssten aus Steuermitteln finanziert werden, meinte die Verbandschefin. „Es kann nicht sein, dass immer mehr auf die Kassen abgewälzt wird.“
Corona - Wegmarke für (kleine) Veränderungen
Statements wie dieses lassen erahnen, dass in Post-Corona-Zeiten das hochgelobte neue Miteinander bald wieder verlorengehen könnte. Trotzdem war man tendenziell der Auffassung, die Corona-Pandemie sei eine Wegmarke für nachhaltige Veränderungen, habe vor allem die Türen für digitale Anwendungen im Gesundheitssystem aufgestoßen, aber auch den Anstoß gegeben, sektorale Grenzen zu lockern. Die Krise werde viele Auswirkungen auf den einzelnen und die Gesellschaft haben, meinte Andrea Grebe. „Das wird sich ins kollektive Gedächtnis einbrennen.“
Nur einer widersprach: Norbert Suttorp glaubt zwar, dass wir in zehn Jahren noch über die Pandemie sprechen werden, so wie wir heute über 9/11 oder die Finanzkrise sprechen, aber im Grunde genauso weitermachen wie bisher. „Dabei verpassen wir wichtige Ereignisse, die zunächst immer eher schleichend daherkommen“, sagte er mit Blick auf Bedrohungen wie den Klimawandel und unseren rüden Umgang mit Tier und Natur. Beides hat eben auch zoonotische Krankheiten zur Folge, wie SARS, MERS, Vogelgrippe, Schweingerippe und jetzt das Coronavirus Sars COV-2 zeigen. „Das häuft sich verdammt in ein, zwei Jahrzehnten, das hatten wir früher so nicht“, sagte der Infektionsmediziner. Er rechnet fest damit, dass die aus dem Tierreich übergesprungenen Krankheiten weiter zunehmen werden.
Tatsächlich spricht momentan nichts dafür, dass Corona an dem menschengemachten Problem etwas ändern könnte. Nimmt man die Experten beim Wort, könnten wir aber zumindest etwas besser vorbereitet sein auf die nächste Pandemie.