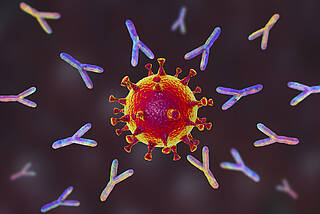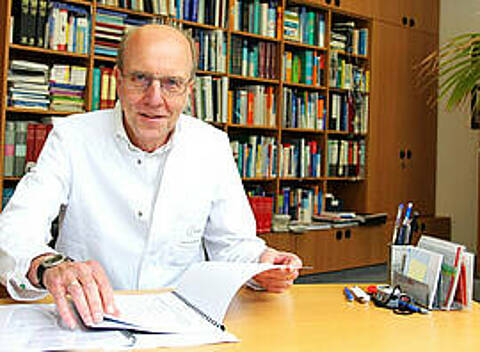Charité und Vivantes testen Proben jetzt auch auf Mutationen

Wie verbreitet ist die englische und südafrikanische Virusvariante in Berlin? Charité und Vivantes untersuchen jetzt systematisch positive Patientenproben auf die beiden Mutationen – Foto: ©luchschenF - stock.adobe.com
Die Charité und die Vivantes-Kliniken lassen Proben mit positivem SARS-CoV-2-Nachweis zusätzlich auf die englische und südafrikanische Virusvariante prüfen. Damit wollen die Kliniken einen Überblick schaffen, inwieweit die beiden Virusmutanten in Berlin verbreitet sind. Daraus kann abgeleitet werden, ob sich die mutierten Viren im Vergleich zu anderen Viren schneller verbreiten, wie internationale Daten vermuten lassen.
Betroffene, die an der Charité oder einer Vivantesklinik jetzt positiv auf Corona getestet werden, erfahren das Ergebnis der Mutationsanalyse aber nicht. Ihnen wird lediglich mitgeteilt, dass sie SARS-CoV-2 positiv sind.
Die zusätzlichen Analysen werden in Kürze vom gemeinsamen „Labor Berlin“ durchgeführt, im Moment erfolgen sie noch im Institut für Virologie der Charité.
PCR weist auch Mutationen nach
Um zu bestimmen, ob es sich um die englische oder südafrikanische Virusvariante handelt, werden verschiedene Analysen per PCR (Polymerase-Kettenreaktion) hintereinandergeschaltet. Der erste PCR-Test prüft, ob die Probe bestimmte Abschnitte des Erbguts von SARS-CoV-2 enthält. Er gibt Aufschluss darüber, ob die getestete Person infiziert ist oder nicht. Positive Proben werden anschließend mittels einer weiteren PCR daraufhin überprüft, ob sie die Mutation N501Y beherbergen. Diese sogenannte Markermutation tritt unter anderem in der englischen, südafrikanischen und brasilianischen Virusmutante auf. Um schließlich die einzelnen Mutanten zu unterscheiden, werden Proben, die die N501Y-Mutation aufweisen, auf zusätzliche Markermutationen hin untersucht.
Zur Qualitätskontrolle und für Forschungszwecke erfolgt zusätzlich eine Sequenzierung positiv getesteter Proben. Hierzu wird für ausgewählte positive Proben die Sequenz des Viruserbguts bestimmt, also das Erbmaterial Baustein für Baustein abgelesen. Die ermittelten Sequenzen werden in der Datenbank des Instituts für Virologie für die weitere Forschung zugänglich gemacht. Gleichzeitig werden die Sequenzen an das Robert Koch-Institut übermittelt und der internationalen Datenbank GISAID zur Verfügung gestellt.
Such nach weiteren Virusvarianten geplant
Künftig soll am Labor Berlin mittels Sequenzierung der Virusgenome nach weiteren Virusmutationen gesucht werden. Damit soll sichergestellt werden, dass auch andere Veränderungen des neuartigen Coronavirus frühzeitig entdeckt werden. Deutschland hat in diesem Punkt einiges nachzuholen. Während England 150.000 Sequenzierungen pro Woche durchführt, sind es in Deutschland in zehn Monaten Pandemie noch keine 1.000 gewesen.
Foto: © Adobe Stock/ luschenF