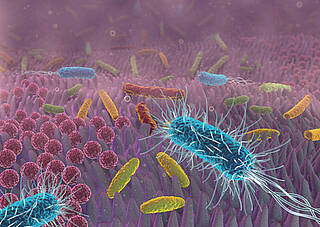Mit fünf Regeln das Risiko für Darmkrebs senken

Wer fünf Regeln beherzigt, kann sein Risiko für Darmkrebs senken – Foto: ©Janina Dierks - stock.adobe.com
Darmkrebs ist derzeit in Deutschland bei Männern die dritthäufigste und bei Frauen die zweithäufigste Tumorerkrankung. "Unter anderem sind dafür die Ernährungs- und Lebensgewohnheiten verantwortlich", erklärt Michael Hoffmeister vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ).
Aber jeder könne sein Darmkrebsrisiko senken, indem er auf einen gesunden Lebensstil achtet. Das zeigt eine Untersuchung von mehr als 4.000 Darmkrebs-Patienten und 3.000 gesunden Kontrollpersonen. Hoffmeister und seine Kollegen vom DKFZ ermittelten die Auswirkungen von beeinflussbaren Lebensstilfaktoren. Mit fünf Regeln lässt sich das Risiko für Darmkrebs senken.
Mit fünf Regeln das Risiko für Darmkrebs senken
Wer möglichst viele dieser fünf Regeln befolgt, kann sein Risiko für Darmkrebs am ehesten senken: Nicht Rauchen, Alkohol nur in geringen Mengen konsumieren, sich gesund ernähren, körperlich aktiv sein, das Normalgewicht halten. Dies gilt unabhängig vom genetischen Darmkrebsrisiko. Auch wer genetisch bedingt ein leicht erhöhtes Risiko hat, kann seine Erkrankungswahrscheinlichkeit durch einen gesunden Lebensstil senken, heißt es weiter in einer Pressemitteilung.
Teilnehmer, die nicht rauchten, sich gesund ernährten und körperlich aktiv waren, hatten bereits ein niedrigeres Darmkrebsrisiko als Teilnehmer, die sich bei keinem der fünf Lebensstilfaktoren an die gesunde Variante hielten. Wer aber einen durchweg gesunden Lebensstil pflegte, sprich alle fünf Lebensstilfaktoren beherzigte, hatte das niedrigste Darmkrebsrisiko.
Darmkrebs: Jeder einzelne Lebenstil-Faktor reduziert das Risiko
Die fünf Lebensstilfaktoren erwiesen sich als etwa gleich bedeutend in der Darmkrebsprävention. "Es spielte eine untergeordnete Rolle, ob es das Nichtrauchen, die gesunde Ernährung oder die körperliche Aktivität war, die beherzigt wurden. Mit allen Varianten reduzierten die Studienteilnehmer ihr Darmkrebsrisiko", ergänzt Prudence Carr, Erstautorin der entsprechenden Studie.
Konsequenzen für das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, hat allerdings auch die genetische Ausstattung. In den vergangenen Jahren wurden mehr als 50 Genvarianten entdeckt, die das Darmkrebsrisiko leicht erhöhen.
Darmkrebs: Lebenstil hilft auch bei erhöhtem genetischen Risiko
So gibt es Menschen, die aufgrund ihres genetischen Profils ein etwas höheres Risiko haben, an Darmkrebs zu erkranken als andere. Ungefähr 5 von 100 Erkrankten haben solch eine eine erbliche Form von Darmkrebs. Dabei handelt es sich entweder um die "familiäre adenomatöse Polyposis" oder um das "hereditäre nicht polypöse kolorektale Karzinomsyndrom". Diese beiden Formen treten meist schon in jungen Jahren auf.
"Unsere Studie zeigt, dass sie ihr Darmkrebsrisiko durch einen gesunden Lebensstil ebenso senken können wie diejenigen, die ein geringeres genetisches Risiko haben", betont Carr. Der Zusammenhang zwischen Lebensweise und Darmkrebsrisiko bestand auch unabhängig von der familiären Vorgeschichte der Studienteilnehmer. Es spielte auch keine Rolle, ob sie in der Vergangenheit schon einmal eine Darmspiegelung gehabt hatten oder nicht.
Darmkrebs weltweit eine der häufigsten Krebsarten
Mit der gesünderen Lebensweise reduziert sich auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und viele andere Krankheiten, betont Hoffmeister. Die entsprechende Studie erschien im Fachmagazin Gastroenterology. In weiteren Studien möchten die DKFZ-Wissenschaftler nun untersuchen, wie stark sich trotz eines leicht erhöhten genetischen Risikos durch mehrere vorbeugende Maßnahmen das Darmkrebsrisiko absenken lässt.
Trotz großer Fortschritte bei Prävention und Früherkennung ist Dickdarmkrebs weiterhin eine der häufigsten Krebserkrankungen weltweit. Im Jahr 2018 werden in Deutschland laut Schätzung der deutschen epidemiologischen Krebsregister und des Zentrums für Krebsregisterdaten im Robert-Koch-Institut 33.000 Männer und 26.000 Frauen an einem sogenannten kolorektalen Karzinom erkranken.
Bei früher Diagnose des Darmkrebs gute Heilungschancen
Man geht davon aus, dass bei früher Diagnose 90 Prozent aller Darmkrebspatienten geheilt werden können. Daher spielt gerade beim Darmkrebs die Früherkennung eine wichtige Rolle. Die entsprechenden Untersuchungen werden ab dem 50. Lebensjahr angeboten.
Die Darmkrebs-Früherkennung ist für Personen gedacht, die keine Anzeichen und kein besonderes Risiko für Darmkrebs haben. Menschen zum Beispiel mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen werden häufigere Untersuchungen empfohlen, heißt es bei den vom IQWIG betriebenen gesundheitsinformationen.de. Zu diesen Erkrankungen gehören Colitis ulcerosa und Morbus Crohn.
Immunologischer Stuhltest oder Darmspiegelung
In Deutschland bieten die Krankenkassen zwei Untersuchungen zur Früherkennung von Darmkrebs an: einen Stuhltest, bei dem der Stuhl auf nicht sichtbare Blutspuren untersucht wird. Die neuen immunologischen Stuhltests (iFOBT/FIT) weisen Blut im Stuhl mithilfe von Antikörpern nach. Diese binden spezifisch an den Blutfarbstoff Hämoglobin. Ein Vorteil dieser Tests: Sie weisen tatsächlich nur menschliches Blut nach und sind deshalb weniger störanfällig - zum Beispiel durch rohes oder nicht durchgebratenes rotes Fleisch, das man vorher gegessen hat.
Die zweite Früherkennungs-Methode ist die Darmspiegelung zur endoskopischen Untersuchung des Dickdarms (Koloskopie). Dabei können dann auch vorhandene Polypen entfernt werden. Gesetzlich Versicherte können zwei kostenlose Spiegelungen in Anspruch nehmen: die erste ab 55 Jahren, die zweite zehn Jahre später. Wurde bei der ersten Darmspiegelung ein Polyp entfernt, wird meist eine Wiederholung der Untersuchung in kürzeren Abständen empfohlen.
Ab 2019 können Männer ab 50 Koloskopie machen lassen
Ab 2019 wird es eine Änderung geben: Dann können Männer bereits ab 50 Jahren eine Darmspiegelung machen lassen. Studien haben gezeigt, dass ihr Risiko in dem Alter höher ist als das von Frauen - darauf weist der Krebsinformationsdienst hin.
Eine dritte Variante der Früherkennung ist die kleine Darmspiegelung (Sigmoidoskopie). Diese Untersuchung wird in Deutschland im Rahmen der Früherkennung jedoch nicht von den Krankenkassen erstattet. Grundsätzlich gilt: Wer Beschwerden hat, kann die Ursache immer kostenlos abklären lassen - gleichgültig, ob und wann zuletzt eine Früherkennungsuntersuchung wahrgenommen wurde.
Darmkrebs bleibt lange unbemerkt
Darmkrebs verursacht anfangs oft keine Beschwerden und kann dadurch zunächst unbemerkt bleiben. Manchmal äußert er sich zum Beispiel durch Schmerzen im Bauch oder veränderte Stuhlgewohnheiten. Es kann sich die Häufigkeit oder übliche Tageszeit der Toilettengänge verändern, oder man neigt eher zu Verstopfung oder Durchfall.
Schwarzer oder sehr dunkler Stuhl kann auf Blutspuren hinweisen und ebenfalls ein Anzeichen für Darmkrebs sein. Bei fortgeschrittenem Darmkrebs können Gewichtsverlust, Übelkeit und Appetitlosigkeit hinzukommen. Diese Symptome können jedoch auch viele andere Ursachen haben. Meist steckt entweder etwas Harmloses dahinter oder die Symptome deuten auf eine andere, gutartige Erkrankung hin, zum Beispiel auf vergrößerte Hämorrhoiden - oder aber eine entzündliche Darmerkrankung.
Darmkrebs entwickelt sich aus gutartigen Wucherungen
Darmkrebs entwickelt sich über viele Jahre. Eine erste, noch harmlose Stufe sind gutartige Wucherungen der Schleimhaut. Sie werden Polypen oder Adenome genannt. Manche wachsen eher warzenartig als kleine Hügel, andere wie gestielte Pilze. Darmpolypen sind mit zunehmendem Alter weit verbreitet. Etwa ein Drittel der Erwachsenen über 55 Jahre hat zumindest einen Polypen im Darm.
Die große Mehrzahl dieser Polypen bleibt klein und harmlos. Manche wachsen aber über Jahre, und einige werden bösartig. Wenn sich ein Polyp bösartig entwickelt, besteht das Risiko, dass die Krebszellen tiefer in die Darmwand einwachsen. Schreitet der Tumor weiter fort, kann er sich in andere Organe wie die Leber ausbreiten. Diese Verbreitung von Krebszellen nennt man Metastasierung.
Verlauf der Erkrankung bei Darmkrebs
Wie die Erkrankung verläuft, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Wenn ein kleiner, örtlich begrenzter Darmtumor im frühen Stadium entfernt wird, sind die Aussichten (Prognose) gut: Die meisten Menschen sind nach der Operation geheilt. Wenn ein Darmkrebs schon fortgeschritten ist, sind die Chancen auf vollständige Heilung schlechter.
Wenn sich Metastasen gebildet haben, ist eine Heilung meistens nicht mehr zu erwarten. Die Behandlung zielt dann darauf ab, das Fortschreiten des Tumors zu bremsen und trotz Darmkrebs so lange wie möglich eine gute Lebensqualität zu erhalten. Ob ein Krebs vollständig entfernt wurde, zeigt sich in der Regel in den ersten fünf Jahren nach der Behandlung. Wie hoch das Risiko für ein erneutes Auftreten ist, hängt unter anderem davon ab, in welchem Stadium der Krebs war. Über das gesamte Leben betrachtet, sterben schätzungsweise 32 von 1.000 Männern und 26 von 1.000 Frauen an Darmkrebs.
Foto: janina dierks/fotolia.com