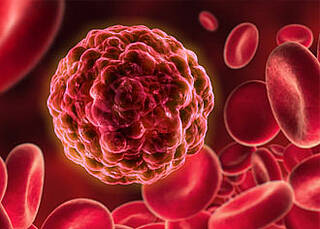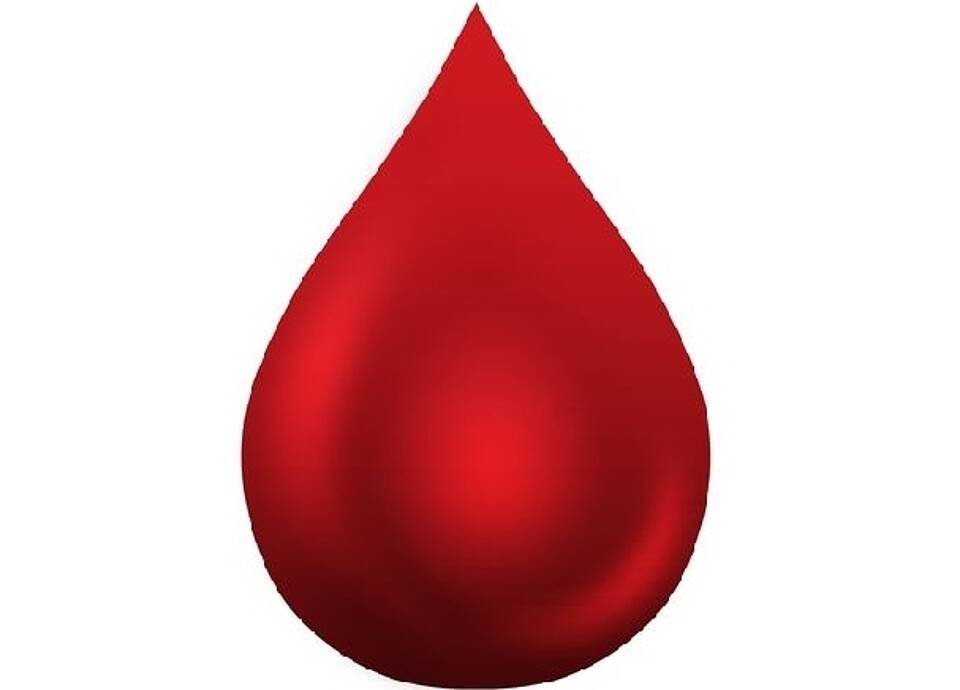
Am 17. April ist Welttag der Hämophilie – Foto: giadophoto - Fotolia
Der jährlich am 17. April stattfindende Welttag der Hämophilie wurde 1989 durch die World Federation of Hemophilia (WFH) eingeführt, um die Öffentlichkeit über die "Bluterkrankheit" zu infomieren. Das Datum soll an den Kanadier Hans Schnabel erinnern, der 1963 die World Federation of Haemophilia gründete und an einem 17. April geboren wurde. Weltweit leiden nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO über 400.000 Menschen an Hämophilie.
Hämophilie kann lebensbedrohlich sein
Hämophilie ist eine Erbkrankheit, bei der die Blutgerinnung gestört ist. Sie äußert sich dadurch, dass die Blutgerinnung nur sehr langsam oder überhaupt nicht einsetzt. Häufig kommt es auch zu spontanen Blutungen, die ohne sichtbare Wunden auftreten. Bei leichten Formen der Hämophilie treten meist nur wenige Beschwerden auf; bei schweren Formen führen jedoch schon kleine Verletzungen zu starken Blutungen nach außen, ins Gewebe, in Muskeln oder Gelenke. Betroffene Personen werden umgangssprachlich auch als "Bluter" bezeichnet.
Lebensgefahr droht den Patienten vor allem bei inneren Blutungen, die erst spät entdeckt werden und schwer zu stillen sind. Unterschieden werden die Hämophilie A und die seltenere Hämophilie B. In Deutschland ist etwa einer von 10.000 Menschen von der Hämophilie A und einer von 30.000 Menschen von der Hämophilie B betroffen. Hämophilie A und Hämophilie B unterscheiden sich darin, welcher Gerinnungsfaktor betroffen ist.
Hämophilie meist erblich bedingt
Hämophilie tritt fast ausschließlich bei Männern auf, und die meisten Fälle sind erblich bedingt. Ein verändertes Gen auf dem X-Chromosom sorgt dafür, dass ein für die Blutgerinnung notwendiges Eiweiß nicht oder nur unzureichend gebildet wird. Da die Vererbungsregeln für die Hämophilie seit Jahren bekannt sind, ist es möglich, das statistische Risiko einer Erkrankung innerhalb einer Familie zu berechnen.
Um die Blutgerinnung zu normalisieren, kann der bei der Hämophilie fehlende Gerinnungsfaktor ersetzt werden. Er wird entweder aus Spenderblut gewonnen oder gentechnisch (rekombinant) hergestellt. Rekombinante Gerinnungsfaktoren gelten zurzeit als sicherste Behandlungsoption, da eine Verunreinigung mit infektiösen Keimen im Gegensatz zur Blutspende praktisch ausgeschlossen werden kann. Ein Problem besteht allerdings in der geringen Ausbeute und den hohen Kosten in der Herstellung.
Foto: © giadophoto - Fotolia.com