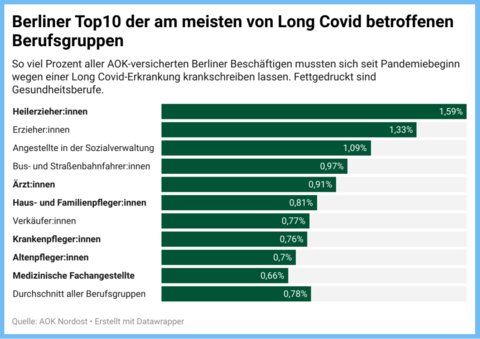Meningeome manchmal gar nicht so harmlos

Schnellwachsend und raumfordernd: Meningeome ab Grad II aufwärts gehören nach der OP bestrahlt. Medikamente gibt es praktisch nicht – Foto: Kzenon - Fotolia
Meningeome sind eigentlich die „Guten“ unter den Hirntumoren. Anders als Gliome sind sie erstens meist gutartig und zweitens kapselartig vom restlichen Gehirn abgegrenzt. Grad I Meningeome verdrängen zwar das Gehirn, wachsen aber langsam und sind kein großes therapeutisches Problem. Oftmals machen sie lange überhaupt keine Symptome, so dass die Diagnose vielfach ein Zufallsbefund ist. Experten schätzen, dass zwei bis drei von 100 Frauen über 70 Jahre von einem Meningeom betroffen sind, viele ohne es zu wissen. „Ziel Nummer 1 ist das Meningeom vollständig zu entfernen, was in der Regel auch recht einfach ist“, berichtete Prof. Hartmut Vatter auf dem 38. Hirntumorinformationstag am Samstag in Berlin. Selbst wenn Tumorreste zurückblieben, sei dies „hinnehmbar“. „Um ein Rezidiv zu bekommen, muss man lange genug leben“, erläuterte der Leiter der Neurochirurgischen Universitätsklinik Bonn die vergleichsweise harmlose Situation bei Grad I Tumoren. In der Regel komme der Tumor erst Jahrzehnte später zurück.
Restlose Tumorentfernung ab Grad II unmöglich
Ganz anders sieht es bei den deutlich selteneren Meningeomen mit WHO Grad II und höher aus. Diese Hirntumore wachsen deutlich schneller und sind alles andere als harmlos, wenn sie in der Nähe des Hirnstamms oder der Hirnanhangdrüse liegen. Denn dort befinden sich äußerst wichtige Strukturen: unter anderem die Hauptschlagader, die das Gehirn mit Blut versorgt, der Sehnerv und nicht zuletzt die Hypophyse selbst, die durch den Tumor nicht mehr richtig arbeiten kann. Grad III Meningeome gelten zudem als bösartig und infiltrieren das Gehirn. Vollständig entfernen ließen sich diese komplexen Hirntumore so gut wie nie, erklärte Experte Hartmut Vatter auf dem Patiententag.
Studiendaten zeigen, dass es einem Drittel der Patienten nach der OP sogar schlechter geht als vorher. Selbst nach Teilresektionen bleiben bei einem Fünftel dauerhafte Schäden zurück. Eine Operation auf Teufel komm raus ist heutzutage deshalb nicht mehr angesagt. „Wir wissen, dass eine vollständige Resektion nicht mehr mit der Lebensqualität vereinbar ist“, betonte Vatter, „darum gehen wir heute deutlich zurückhaltender vor.“ Das bedeutet, dass die Ärzte lieber Tumorreste im Gehirn stehen lassen, als Defizite beim Sehen, Schlucken, Hören oder anderen wichtigen Funktionen in Kauf zu nehmen.
Platz schaffen für die Bestrahlung des Meningeoms
Bei der Operation höhergradiger Meningeome geht es in erster Linie darum, Platz für die wichtigen Strukturen des Gehirns zu schaffen, aber auch Platz für eine nachfolgende Strahlentherapie. Die stereotaktische Bestrahlung ist bei komplexen Meningeomen das postoperative Mittel der Wahl, nach dem Grundsatz: Was nicht weggeschnitten werden kann, wird wegbestrahlt. „Die entscheidende Frage ist, wann die chirurgische Resektion beendet werden muss und optimale Voraussetzungen für die Bestrahlung geschaffen sind“, erläuterte Hartmut Vatter die Herausforderung für den Operateur.
Unterstützung bekommen Neurochirurgen neuerdings durch die Adjuvnante Hybrid Surgery (AHS). Das medizintechnische System wurde speziell für Schädelbasistumore entwickelt, um die richtige Balance zwischen chirurgischem Risiko und Strahlenschäden zu finden. „Wenn man das gut macht, kann man relativ gut bestrahlen“, meinte der Neurochirurg vom Universitätsklinikum Bonn.
Viel mehr als Operation und Strahlentherapie haben die Ärzte auch nicht in petto. Zur Chemotherapie ist die Datenlage offenbar so dünn, dass man sie nicht ernsthaften zu den Therapieoptionen bei Meningeomen zählen kann, geschweige denn irgendwelche andere Krebsmedikamente. Wenn eine Chemotherapie gegeben wird, dann ist es aus Sicht von Meningeom-Spezialist Vatter „eher eine Verzweiflungstat.“
Bei Glioblastomen gehen Ärzte in die Offensive
Bei den wesentlich aggressiveren Glioblastomen scheint das therapeutische Konzept dagegen genau anders herum zu funktionieren. Neurochirurgen gehen da heute wesentlich offensiver vor. Eine möglichst radikale Tumorentfernung – auch im Rezidivfall – hat nach Informationen von Charité Chefarzt Prof. Peter Vajkoczy, wissenschaftlicher Leiter des diesjährigen Hirntumorinformationstags, erhebliche Verbesserungen in der Therapie des Glioblastoms gebracht. Die Strategie „viel hilft viel“ hilft demnach gerade besonders gut, die gefürchteten neurologischen Defizite zu vermeiden; in erster Linie, weil die Operationsverfahren nach Expertenauskunft wesentlich präziser und somit schonender geworden sind. Hinzukommt, dass mit der Chemotherapie Temodal und dem Angiogenesehemmer Avastin zumindest temporär hoch wirksame Medikamente zur Verfügung stehen. „Wir sehen große Fortschritte bei der Lebensqualität“, erklärte der Neurochirurg vor rund 400 Zuhörern am Samstag in Berlin. Weiter seien Erfolge beim Gesamtüberleben zu verzeichnen, sagte er mit Blick auf Daten, wonach heute jeder vierte Patient mit einem Glioblastom länger als zwei Jahre nach der Diagnose lebt. Vajkoczy: „Das sind Dinge, die vor 20 Jahren noch unvorstellbar waren.“
Foto: © Kzenon - Fotolia.com