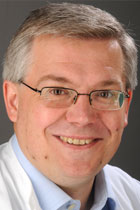Ein hoher Lichtschutzfaktor ist nicht das einzige, worauf Eltern beim Kauf von Sonnencremes für ihre Kinder achten sollten – Foto: ©nadezhda1906 - stock.adobe.com
Die Sonne scheint und das Eincremen mit UV-Schutzmitteln gehört in vielen Familien zur morgendlichen Routine. Gerade Kinder benötigen einen hohen Lichtschutzfaktor, um ihre empfindliche Haut vor der UV-Strahlung zu schützen. In Anbetracht Hunderter verschiedener Sonnencremes, die sich in den Regalen von Drogerien befinden, haben die Eltern die Qual der Wahl. Welches Sonnenschutzmittel ist wirklich für Kinder geeignet?
Die Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände ABDA rät von Sonnenschutzmitteln mit UV-Filtersubstanzen wie Octocrylen oder Ethylhexyl-Methoxy-Cinnamat (EHMC) definitiv ab. „Mindestens bis zum Schulalter sollten Kinder besser mit physikalischen Sonnenschutzmitteln mit Mikropigmenten wie Zinkoxid oder Titandioxid eingecremt werden“, sagt Prof. Peter Höger, Chefarzt der Abteilungen Pädiatrie und Pädiatrische Dermatologie am Katholischen Kinderkrankenhaus Wilhelmsstift in Hamburg.
Für kleine Kinder besser physikalische UV-Schutzmittel nutzen
UV-Filter, die in die Haut einziehen, können bei Kindern durch die Haut ins Blut aufgenommen werden. Einige dieser Substanzen können bei Kindern sogar östrogene Wirkungen haben. Darum der Rat zu physikalischen Sonnenschutzmitteln für Kinder.
Die Haut von Kindern unterscheidet sich deutlich von der Erwachsener. Sie ist dünner und ihre Oberfläche ist bezogen auf das Körpergewicht viel größer. Die kindliche Hautbarriere ist noch unreif und die Anzahl der Talgdrüsen pro Fläche höher. Dadurch können verschiedene Substanzen leichter durch die Haut aufgenommen werden und ins Blut gelangen.
Dutzende Inhaltsstoffe können zu Kontaktallergien führen
Das gilt nicht nur für Sonnenschutzmittel, sondern auch für jedes andere Pflegeprodukt. "Bereits Säuglinge erhalten im Schnitt 8 verschiedene Hautpflegeprodukte mit durchschnittlich 48 verschiedenen Inhaltsstoffen. Weniger wäre besser“, sagt Kinderdermatologe Höger. Der Begriff 'hypoallergen' etwa sei rechtlich nicht geschützt und in erster Linie Marketing, warnt Höger. Zum Beispiel könnten Pflegeprodukte mit Wollwachsalkoholen zu Kontaktallergien führen. Ebenfalls kritisch zu betrachten sind Duftstoffe, da diese Irritationen und Kontaktallergien hervorrufen können.
Die Problematik, dass Inhaltsstoffe aus Cremes und Salben bei Kindern leichter ins Blut gelangen, betrifft auch Arzneimittel. Kinder sollten zum Beispiel keine lokal angewendeten Antibiotika mit den Antibiotika Neomycin, Gentamicin oder Silber-Sulfadiazin erhalten. Laut Höger können sie nach Resorption systemische Nebenwirkungen hervorrufen, Kontaktallergien verursachen, außerdem sind inzwischen viele Bakterien gegen sie resistent.
Keine Insektenmittel mit DEET auf Kinderhaut
Lokalanästhetika mit Benzocain, Lidocain oder Prilocain können bei Kindern zu einer Methämoglobinämie führen. Alkoholische Lösungen können bei Säuglingen auch dann das Gehirn oder die Leber schädigen, wenn sie auf die Haut aufgetragen werden.
Auch die großflächige Anwendung insektenabwehrender Zubereitungen – sogenannte Repellents - mit dem Wirkstoff DEET sind für Kinder ungeeignet. Sie können bei Kindern zu Nervenschäden führen, weiß Kinderarzt Höger.
Foto: © nadezhda1906 - Fotolia.com