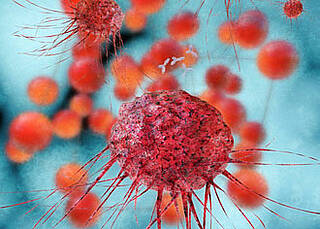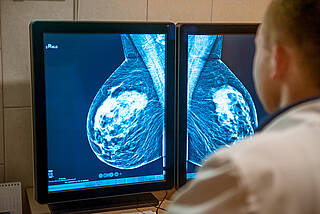PARP-Inhibitoren bieten neue Chancen bei fortgeschrittenem Eierstockkrebs

PARP-Inhibitoren sind eine vielversprechende Therapieoption bei Eierstockkrebs. Bei BRCA-Mutationen sind die Ansprechraten am besten
In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 8.000 Frauen an Eierstockkrebs. Bei etwa fünf bis zehn Prozent liegt ein erblicher Eierstockkrebs vor. Bei dieser Variante sind Mutationen in den Hochrisikogenen BRCA- 1 oder 2 die Auslöser der Erkrankung.
So oder so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Tumor auch nach zunächst erfolgreicher Standardtherapie schnell zurückkehrt. Ein Grund ist, dass in mehr als zwei Drittel der Fälle die Erkrankung erst in einem weit fortgeschrittenen Stadium entdeckt wird. Denn Eierstockkrebs macht lange keine spezifischen Beschwerden und ein Screening zur Früherkennung gibt es nicht.
60 Prozent sterben innerhalb von 5 Jahren
Dementsprechend gering ist die Lebenserwartung: Momentan liegt das relative 5-Jahresüberleben im Schnitt bei 41 Prozent.
Durch Einführung der PARP-Inhibitoren verschieben sich aber gerade diese Zahlen. Frauen mit erblichem Ovarialkarzinom haben dank der zielgerichteten Wirkstoffe eine wesentlich höhere Überlebenswahrscheinlichkeit: PARP-Inhibitoren zeigen bei ihnen das höchste, mitunter jahrelange Ansprechen. Der PARP-Inhibitor Olaparib verlängert den durchschnittlichen Zeitraum bis zum ersten Rezidiv von rund einem auf gut vier Jahre, wie eine aktuelle internationale Studie zeigt. Bei wiederholten Auftreten des Tumors, lässt sich der Zeitraum bis zu einem erneuten Rezidiv mittels PARP-Inhibitoren plus Chemotherapie ebenfalls deutlich verlängern.
PARP-Inhibitoren machen Hoffnung auf Heilung
„Das Risiko, dass die Krankheit in den ersten dreieinhalb Jahren nach der Standardtherapie zurückkehrt, wird durch die anschließende Behandlung mit PARP-Inhibitoren um rund 70 Prozent gesenkt“, erklärt PD Dr. Karin Kast, von der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Universitätsklinikums Dresden. „Langfristig werden wir hierdurch möglicherweise auch bei mehr Patientinnen eine Heilung erzielen.“
Im vergangenen Sommer wurde die Zulassung von Olaparib erweitert. Seither können auch Eierstockkrebspatientinnen ohne BRCA-Mutation den PARP-Inhibitor verschrieben bekommen, wenn die Erkrankung erst nach längerer krankheitsfreier Zeit wieder aufgetreten ist und der Tumor gut auf die zunächst verabreichte Chemotherapie mit Carboplatin angesprochen hat. In diesem Fall seien die erzielten krankheitsfreien Zeiten zwar weniger lang als bei Vorliegen einer Veränderung in den BRCA-Genen, aber dennoch signifikant länger als ohne diese Medikation, betont Prof. Pauline Wimberger, Direktorin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Dresden.
Jahrelanges Ansprechen war früher undenkbar
„Circa zehn Prozent der Patientinnen mit einem späten Wiederauftreten der Eierstockkrebserkrankung zeigen erfreulicherweise ein jahreslanges Ansprechen, eine Chronifizierung der Erkrankung, was früher undenkbar gewesen wäre“, so Prof. Wimberger. Künftige Studien sollen zeigen, ob der innovative Wirkstoff bei den genannten Krebsarten ohne BRCA-Mutation auch in einem frühen Stadium der Erkrankung deutliche Vorteile bringt.
Dadurch könnte sich die Zahl der Patientinnen noch einmal deutlich erhöhen, die von PARP-Inhibitoren profitieren.
Die Behandlung mit PARP-Inhibitoren wird aktuell allerdings noch nicht flächendeckend von den Krankenkassen übernommen. Ärzte können aber einen Antrag auf Kostenübernahme stellen. „Wir stellen für jede unserer Patientinnen, bei der die Behandlung angezeigt ist, einen entsprechenden Antrag bei der jeweiligen Krankenkasse – ein übliches Prozedere bei neuen Medikamenten“, sagt Dr. Kast. Weitere Patientinnen könnten im Rahmen von klinischen Studien behandelt werden. "Künftig wird die vielversprechende Behandlung hoffentlich noch weit mehr Patientinnen zu Gute kommen“, so Dr. Kast.
Warum PARP-Inhibitoren so gut bei erblichem Eierstockkrebs funktionieren
Die Gene BRCA1/2 sind für die Reparatur von Fehlern in der Erbinformation menschlicher Zellen (DNA) verantwortlich. Träger dieser Mutation erkranken häufiger und vergleichsweise jung an Brust- und Eierstockkrebs sowie weiteren Krebsarten. Die gestörten Reparaturmechanismen sind zum einen Ursache des Krebsleidens, bilden aber auch die Achillesferse für die Tumorzellen. Diese müssen nämlich auf alternative Formen der DNA-Reparatur ausweichen, wenn sie selbst überleben wollen. Hierbei spielt das Enzym Poly-ADP-Ribose-Polymerase (PARP) eine wichtige Rolle. Wenn dieses medikamentös gehemmt wird – durch PARP-Inhibitoren – dann kommt es insbesondere bei BRCA1- oder BRCA2-mutierten Tumorzellen gehäuft zum Zelltod. Dies gilt auch dann, wenn nicht nur die Eierstöcke, sondern auch die Eileiter- oder das Bauchfell vom Krebs befallen sind.
Aktuelle Studien untersuchen, ob PARP-Inhibitoren auch bei weiteren BRCA-assoziierten Krebsarten wirksam sind – etwa bei Brust-, Prostata- und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Eine Zulassung für entsprechende metastasierte Brustkrebserkrankungen wird in Kürze in Deutschland erwartet.
Foto: © magicmine - Fotolia.com