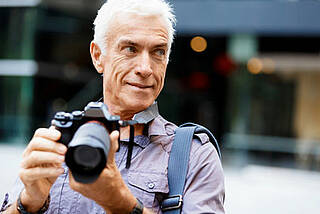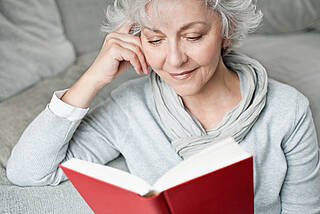Zweisprachige bauen mehr graue Substanz auf.
Es gibt etliche Hinweise, dass zweisprachige Menschen im Alter oft länger geistig fit bleiben. Eine aktuelle Untersuchung im Rahmen der „1.000-Gehirne-Studie“ untermauert diese Annahme. Wie die Forscher um den Jülicher Neurowissenschaftler Prof. Dr. Stefan Heim zeigen konnten, legen Mehrsprachler in jungen Jahren deutlich an Gehirnvolumen zu. Im Alter nimmt das zwar wie bei jedem Menschen wieder ab, doch der Benefit scheint zu bleiben.
An der Studie nahmen 224 Personen, die nur eine Sprache sprechen und 175 Personen, die zwei Sprachen fließend beherrschen, teil. Mittels MRT bestimmten die Forscher das Volumen der grauen Substanz im hinteren unteren Teil des linken Stirnlappens und im unteren linken Scheitellappen. In diesen beiden Hirnregionen ist unter anderem das Sprachverstehen und die Sprachproduktion verortet. Bestimmte Teilbereiche dieser Regionen arbeiten oft zusammen, sind also funktionell und anatomisch bei jedem eng verknüpft.
Mehr graue Substanz bedeutet mehr geistige Reserven
Die Auswertungen zeigen: Die graue Substanz dieser beiden Regionen hat beim Erwerb einer zweiten Sprache in jungen Jahren ein deutlich höheres Volumen. Neurowissenschaftler Stefan Heim erklärt die Zunahme in dieser Schicht mit einer stärkeren Vernetzung der benachbarten Nervenzellen untereinander. Und davon profitiert offenbar die Gehirnleistung. „Ein Zuwachs an grauer Substanz geht nach unserer Erfahrung mit einem Zuwachs der kognitiven Reserve einher – also einer besseren geistigen Leistungsfähigkeit und Flexibilität“, erläutert Stefan Heim.
Mit zunehmendem Alter nimmt die graue Substanz jedoch auch bei den Zweisprachlern ab, wie die Forscher weiter zeigen konnten. Der „Vorsprung" bleibt aber lange erhalten. Erst mit 80 Jahren ist kein Volumenunterschied bei den Ein- und Mehrsprachlern mehr nachweisbar.
Der Vorteil verschwindet nicht
„Zunächst sieht es also so aus, als wenn der Vorteil durch das Erlernen einer zweiten Sprache besonders in jungen Jahren ausgeprägt ist und sich im Alter wieder angleicht“, meint Heim. „Aus den Arbeiten anderer Forschergruppen wissen wir aber, dass der Vorteil nicht einfach verschwindet. Der Überschuss an grauer Substanz wandelt sich mit der Zeit, je fester die neue Sprache ’sitzt‘, in eine engere Vernetzung der Areale und stärker ausgeprägte Kommunikationsleitungen in der weißen Substanz um“, ergänzt er. „Der Informationsaustausch zwischen den Gehirnregionen wird dadurch vereinfacht und ist somit stabiler und effektiver“, fügt Heim an. Dies könnte erklären, wieso Mehrsprachler im Alter oftmals länger geistig fit bleiben.
Zweisprachigkeit soll weiter erforscht werden
Das interdisziplinäre Forscherteam aus Medizinern, Psychologen, Linguisten und Logopäden will nun in einer Folgestudie herausfinden, wie sich die funktionelle ‚Verkabelung‘ – also die Konnektivität – der beiden Sprachregionen bei Mehrsprachlern und Einsprachlern im Alter darstellt. „Nachdem wir nun wissen, wie sich die graue Substanz in den beiden Sprachregionen bei Mehr- und Einsprachlern strukturell verändert, wollen wir nun wissen, wie genau die beiden Regionen interagieren und wie sich dies über die Lebenszeit wandelt“, sagt Prof. Svenja Caspers, Leiterin 1.000-Gehirne-Studie am Jülicher Institut für Neurowissenschaften und Medizin. Eine weitere spannende Frage sei ob das Erlernen einer zweiten oder dritten Sprache mit Eintritt in das Rentenalter einen Vorteil für die geistige Leistungsfähigkeit bringe. "Das wäre für viele Menschen eine praktikable und einfache Methode, eine zusätzliche kognitive Reserve aufzubauen.“
Foto: pixabay