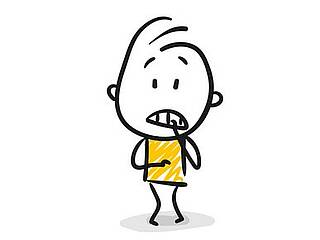Negative Gefühhle wie Angst, Schmerz oder Durst haben einen gemeinsamen Ursprungsort im Gehirn – Foto: ©terovesalainen - stock.adobe.com
Depressionen, Angsterkrankungen, Essstörungen – die genauen Entstehungsmechanismen solcher Erkrankungen sind noch weitgehend ungeklärt. Einem Forscherteam um Nadine Gogolla vom Max-Planck-Institut für Neurobiologie ist es nun gelungen, etwas mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Die Wissenschaftler untersuchten am Mausmodell, wie in der Inselrinde, einem Bereich innerhalb der Großhirnrinde, bestimmte Sinneseindrücke, körperliche Zustände, Gefühle und Emotionen zusammenkommen und wie dies das Verhalten beeinflusst.
Negative Gefühle und Ängste sind wichtig
Gefühle und Emotionen haben einen großen Einfluss auf unser Verhalten, und das ist für das Überleben durchaus wichtig. „Riecht zum Beispiel eine Maus einen Fuchs, dann bringt das Gefühl der Furcht sie dazu, ihre Ausflüge in die Umgebung einzustellen und erst einmal mit dem Fressen aufzuhören“, erklärt Gogolla. Einen ähnlich hemmenden Einfluss haben auch negative Körperzustände wie zum Beispiel Übelkeit. Solch unterschiedliche negativen Empfindungen und Verhaltensanpassungen sind über die hintere Inselrinde miteinander verbunden, wie Gogolla und ihr Team nun zeigen konnten.
Daniel Gehrlach und seine Kollegen aus der Gogolla-Gruppe fanden heraus, dass die Nervenzellen der hinteren Inselrinde auf eine Vielzahl von Sinneseindrücken, Emotionen und Körperzuständen reagieren. Die hier verarbeiteten Informationen haben alle eine negative Auswirkung oder Signalwirkung. Interessanterweise können einzelne Nervenzellen dabei auf so unterschiedliche negative Reize wie Furcht, Schmerz, bitteren Geschmack, Durst und körperliches Unwohlsein reagieren.
Inselrinde über Nervenbahnen mit dem Mandelkern verbunden
Sobald die Zellen solch einen negativen Zustand erkennen, leiten sie die Informationen über zwei unterschiedliche Nervenbahnen zum Mandelkern oder dem Nucleus accumbens weiter. Beide Gehirnregionen sind dafür bekannt, dass sie das Verhalten eines Tieres direkt beeinflussen können. „Wir konnten erstmals zeigen, welchen Einfluss die Inselrinde über diese beiden Verbindungen auf das Verhalten hat“, so Gogolla.
Die Aktivierung der Nervenbahn von der Inselrinde zum Mandelkern bewirkt vor allem Verhaltensanpassungen an Angst: Die Maus reduziert Nahrungsaufnahme, soziale Kontakte und auch das Erkunden der Umgebung. Unterdrückten die Forscher die Aktivität dieser Nervenbahn, waren die Tiere weniger ängstlich.
Nervenzellaktivität bestimmt das Verhalten
Das Aktivieren der Nervenbahn zum Nucleus accumbens hatte dagegen den gleichen Effekt wie eine Krankheit: Die Mäuse hörten auf zu fressen. Interessanterweise konnten die Tiere trotz Übelkeit etwas fressen, wenn diese Nervenbahn inaktiviert wurde. „Durch gezielte Eingriffe und Beobachtungen der Nervenzellaktivität können wir somit in der Maus mechanistische Zusammenhänge zeigen, für die es im Menschen nur indirekte Hinweise gibt“, so Gogolla. Dies sei ein wichtiger Schritt, um Angsterkrankungen, Depressionen und Essstörungen zu verstehen.
Das Gefühl, krank zu sein, bzw. starke negative Emotionen sollen Mensch und Tier dazu bringen, sich zu schonen und schützen. Angsterkrankungen oder Depressionen entstehen hingegen, wenn negative Emotionen zu stark oder zu häufig werden. „Möglicherweise lernt die Inselrinde aus vorherigen Erfahrungen, so dass die Zellen beim nächsten negativen Eindruck stärker oder schneller reagieren“, überlegt Gogolla. „Haben wir solche Zusammenhänge erst einmal verstanden, finden wir vielleicht auch Wege, um sie rückgängig zu machen oder zumindest einzudämmen.“
Foto: © terovesalainen - Fotolia.com