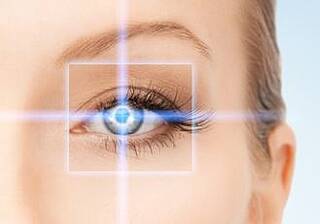OP gegen Kurzsichtigkeit: Vor dem Augenlasern Chancen und Risiken gründlich abwägen

Operationen am Auge sind nicht ohne Risiko – Foto: looking2thesky - Fotolia
Über 50 Millionen Deutsche tragen eine Brille oder Kontaktlinsen und viele fühlen sich dadurch in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Die refraktive Chirurgie, mit der Fehlsichtigkeiten korrigiert werden können, ist daher mittlerweile zu einem lukrativen Geschäft geworden, allen voran die Operationen mittels Laser: Mehr als 100.000 Menschen lassen sich in Deutschland jedes Jahr ihre Augen lasern. Doch die Verfahren sind nicht unumstritten. Einige Experten verteufeln die Methoden als reine Lifestyle-OPs, andere sehen darin die Möglichkeit, die Lebensqualität erheblich zu verbessern. Viele Menschen sind daher verunsichert – auch weil nur wenige Langzeitstudien zu finden sind. Sicher ist: Keines der Verfahren ist ganz ohne Risiko.
LASIK am häufigsten angewendete Methode
Das älteste und als äußerst risikoarm geltende Laserverfahren ist die photorefraktive Keratektomie (PRK). Bei ihr wird das Deckhäutchen der Hornhaut abgeschabt, so dass die darunterliegende Hornhautschicht mittels Laserstrahl modelliert werden kann. Danach muss sich die Deckhaut neu bilden. Das ist mit Schmerzen verbunden, und häufig vergehen nach dem Eingriff sechs Monate, bis das Sehvermögen voll hergestellt ist. Ein schmerzarmes Verfahren, bei dem die Patienten meist schon nach wenigen Stunden besser sehen können, ist die LASIK-Operation. Bei dem Eingriff wird zunächst die oberste Schicht der Hornhaut abgetrennt und der so entstandene Deckel (Flap) zurückgeklappt. Die nun freiliegende Hornhautschicht kann mit dem Laser abgetragen werden. Bei der weiterentwickelten Form der LASIK, der FEMTO-LASIK, wird auch das OP-Messer für den ersten Schnitt durch einen Laser ersetzt. Die LASIK eignet sich für Kurzsichtige bis minus acht Dioptrien, für Weitsichtige bis plus drei Dioptrien.
Studien zufolge brauchen Patienten, die durch das LASIK-Verfahren behandelt wurden, nach der Operation zu neunzig Prozent keine Brille mehr. Das bedeutet aber, dass ein nicht geringer Anteil durchaus noch eine Sehhilfe benötigt oder erneut operiert werden muss. Zudem ist die LASIK-OP mit Risiken verbunden. So kann es in seltenen Fällen dazu kommen, dass die Hornhaut sich nach außen wölbt, was das Sehvermögen so stark beeinträchtigen kann, dass oft nur noch ein Linsenaustausch hilft. Allerdings ist diese Komplikation sehr selten und tritt einer italienischen Langzeitstudie zufolge nur in 0,57 Prozent der Fälle auf.
Blendungseffekte und trockenen Augen häufigste Nebenwirkungen
Häufiger kommt es hingegen zu einer Blendempfindlichkeit durch die OP. Betroffene sehen dann beim Betrachten von Lichtquellen im Dunkeln Doppelbilder oder einen sogenannten Halos, einen Lichtring um das beobachtete Objekt Bei den meisten Patienten verschwinden diese Beschwerden innerhalb der ersten drei Monate. Einige Patienten sind jedoch dadurch dauerhaft so beeinträchtigt, dass sie ihr Auto in der Dunkelheit stehen lassen müssen. Besonders Patienten mit über fünf Dioptrien sind gefährdet; rund bei drei bis vier Prozent sollen hier längerfristig betroffen sein. Zudem kann es, wie nach jeder Operation, zu Infektionen kommen.
Die am häufigsten auftretende Nebenwirkung der LASIK-Methode ist jedoch das trockene Auge, weil bei dem Eingriff die Nerven der Hornhaut, welche die Tränenproduktion anregen, verletzt werden. Trockene Augen dürften auch der Grund dafür sein, dass einer Meta-Analyse US-amerikanischer Forscher aus dem Jahr 2009 zufolge zwar 99 Prozent der Lasereingriffe am Auge ohne große Komplikationen verlaufen, aber nur rund 96 Prozent der Patienten am Ende zufrieden sind. Denn trockene Augen können die Lebensqualität stark beeinträchtigen und zu starken Schmerzen, Jucken, Brennen, einem Fremdkörpergefühl sowie verschwommenen Sehen führen.
Genaue Zahlen darüber, wie viele LASIK-Patienten dauerhaft unter trockenen Augen leiden, gibt es wenige. Kurz nach der OP scheint jeder zweite Patient betroffen zu sein, doch häufig verschwinden die Beschwerden mit Hilfe von Augentropfen innerhalb weniger Tage. Bei einigen Patienten kann das Problem auch mehrere Wochen oder Monate, sogar bis zu einem Jahr bestehen bleiben, und in seltenen Fällen kann es sogar chronisch werden. Besonders gefährdet scheinen Patienten zu sein, die schon vor der LASIK zu trockenen Augen neigten, sowie ältere Menschen. Auch bei stark kurzsichtigen Patienten, bei denen tief in die Hornhaut hinein gelasert werden wird, ist das Risiko erhöht.
Alternativen: LASEK und ReLex
Untersuchungen zufolge scheint die LASEK-Operation zu weniger Störungen des Tränenfilms zu führen als die LASIK. Während bei der LASIK durch einen Schnitt die oberste Hornhautschicht abgetrennt werden muss, wird bei der LASEK die Hornhautoberfläche direkt mit dem Laser korrigiert. Daher wird Patienten mit einer dünneren Hornhaut eher zur LASEK geraten. Nach dem Eingriff müssen allerdings zum Schutz des Auges mehrere Tage spezielle Kontaktlinsen getragen werden. Auch können vorübergehend starke Schmerzen auftreten.
Seit 2011 wird eine weitere Operationstechnik angeboten, die sogenannte ReLEx smile. Hier ist weder ein Flap noch einen langer Heilungsprozess nötig, da der Laser von außen kleine Explosionen unter dem Deckhäutchen bewirkt und damit Gewebe von der obersten Hornhautschicht ablöst, das sich dann durch einen winzigen Schnitt entfernen lässt. Ersten Untersuchungen zufolge soll die Methode die gleichen Erfolge wie LASIK aufweisen, dabei jedoch das Risiko von Blendempfindlichkeit und trockenem Auges reduzieren. Ausgeschlossen ist beides jedoch nicht, und Langzeitstudien fehlen noch. Zudem muss, sollte eine Nachkorrektur notwendig sein, ein anderes Verfahren zum Einsatz kommen. Und das ist nicht unwahrscheinlich, da der Eingriff im Vergleich zu anderen Verfahren seltener die angestrebte Brechkraft exakt trifft.
Kunstlinse als bessere Methode?
Eine Möglichkeit, mit der auch höhere Fehlsichtigkeiten behoben werden können, ist eine implantierbare Kontaktlinse (ICL). Ein trockenes Auge scheint hier seltener aufzutreten, Blendungseffekte können aber vorkommen. Auch treten zu Beginn nicht selten Schmerzen auf, und es besteht ein Risiko für mitunter schwerwiegende Infektionen. In Einzelfällen kann der Augendruck innerhalb der ersten Stunden beträchtlich steigen. Mit Medikamenten kann dem sehr gut entgegengewirkt werden, wenn die Therapie rechtzeitig eingeleitet wird. Im Gegensatz zu Lasereingriffen an der Hornhaut kann eine ICL-Implantation jederzeit rückgängig gemacht werden.
Da alle genannten Methoden Vor- und Nachteile haben und nicht für jeden Patienten geeignet sind, sollten sich Interessierte vor einem Eingriff genau informieren. Dabei ist nicht nur die richtige Methode wichtig, sondern auch die Erfahrung des Chirurgen und die Qualität des Zentrums, an dem die Operation durchgeführt wird. Vor allem sollte darauf geachtet werden, ob beispielsweise Hygienestandards erfüllt sind und eine adäquate Nachsorge gewährleistet wird. Experten warnen zudem vor Billig-Angeboten aus dem Ausland.
Nicht jeder kann sich lasern lassen
Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist eine OP gegen Kurzsichtigkeit nicht geeignet. Auch bei bestimmten Erkrankungen der Augen oder einer sehr dünnen Hornhaut wird man von dem Eingriff ausgeschlossen.
Zudem sollte der Grad der Fehlsichtigkeit soweit stabil sein, dass er sich in den vergangenen Jahren um nicht mehr als 0,5 Dioptrien verändert hat. Wer unter 50 Jahren ist, sollte zudem bedenken, dass im Alter aufgrund der Weitsichtigkeit dennoch eine Brille notwendig werden kann.
Foto: © looking2thesky - Fotolia.com