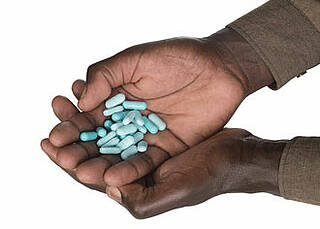"Für Deutschland hat die WHO-Einstufung vom 8. August keine direkte Folge"

Prof. Reinhard Burger
Herr Professor Burger, in Anbetracht der Ebola-Epidemie in Westafrika hat die WHO am 8. August eine „Gesundheitliche Notlage mit internationaler Tragweite“ ausgerufen. Was bedeutet diese Einstufung für Westafrika und den Rest der Welt?
Burger: Diese Einstufung ist verbunden mit Vorgaben zur Umsetzung und hat daher eine wichtige Bedeutung für die betroffenen und die angrenzenden Staaten. Für sie hat die WHO eine Reihe von nachdrücklichen konkreten Empfehlungen zur Eindämmung und Kontrolle des Ausbruchsgeschehens ausgesprochen. Für Deutschland hat die Einstufung keine direkte Folge. Die WHO-Empfehlungen für nicht betroffene und nicht an Westafrika angrenzende Staaten, zum Beispiel das Vorhalten von Diagnoseverfahren für Ebola-Erkrankungen, sind in Deutschland bereits erfüllt.
Wie berechtigt ist die Sorge, Ebola könnte auch nach Deutschland eingeschleppt werden?
Burger: Das Risiko, dass Reisende die Krankheit nach Deutschland oder Europa mitbringen, ist gering, es ist aber nicht auszuschließen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist durch den direkten Kontakt oder über Blut oder andere Körperflüssigkeiten von erkrankten Menschen oder Verstorbenen möglich. Personen im engsten Umfeld dieser Erkrankten hätten daher ein hohes Ansteckungsrisiko. Aber eine generelle Gefährdung unserer Bevölkerung besteht nicht, weil es in Deutschland und Europa alle Voraussetzungen zur sicheren Versorgung Betroffener gibt.
Was bedeutet das genau?
Burger: Für das seuchenhygienische Management in Deutschland gibt es ein Netzwerk von Kompetenz- und Behandlungszentren, die sogenannte STAKOB, die auf den Umgang mit solchen Infektionskrankheiten spezialisiert und vorbereitet sind. Auch in Berlin gibt es ein STAKOB-Behandlungszentrum, auf dem Charité-Campus Virchow-Klinikum. Das RKI arbeitet als Nationales Public Health Institut beim Infektionsschutz mit den Bundesländern eng zusammen. Bundesländer wie Berlin mit einem internationalen Flughafen haben natürlich auch Erfahrung im Umgang mit Erkrankungen, die aus den Tropen eingeschleppt werden. So gibt es in Berlin neben dem Behandlungszentrum auch ein STAKOB-Kompetenzzentrum beim Gesundheitssenat.
Deutschland hält – wie es die WHO empfiehlt - Diagnoseverfahren für Ebola-Erkrankungen vor. Hierfür braucht es sicher Spezialisten?
Burger: Auch in der Diagnostik sind wir in Deutschland gut aufgestellt. Das Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg und die Universität Marburg sind als Referenzlabors international angesehen. Auch das Robert Koch-Institut könnte bei inaktivierten Patientenproben eine erste Diagnostik auf Ebola durchführen. Direkt benachbart zu der Berliner Sonderisolierstation entsteht derzeit im Robert Koch-Institut ein Hochsicherheitslabor, so dass es in Zukunft möglich sein wird, Proben von Verdachtsfällen vollständig vor Ort zu testen.
Virologen des Robert Koch-Instituts sind derzeit in Guinea. Was können Ihre Mitarbeiter vor Ort tun?
Burger: Virologen des Robert Koch-Instituts arbeiten gemeinsam mit anderen deutschen und europäischen Wissenschaftlern in Guinea in einem Europäischen Mobilen Labor, im Rahmen des „European Mobile Laboratory Project“*. Sie haben sich intensiv eingebracht in die Labordiagnostik bei der Versorgung der dortigen Patienten, das Ganze unter nicht einfachen Bedingungen. Eine rasche und verlässliche Diagnostik ist sehr wichtig, damit Erkrankte identifiziert und isoliert und ihre Kontaktpersonen nachverfolgt werden können - damit die Weiterverbreitung unterbrochen werden kann.
* Das European Mobile Laboratory Project ist eine multinationale europäische Initiative, die vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg koordiniert und von der Europäischen Kommission unterstützt wird. Das Labor arbeitet in enger Kooperation mit den Gesundheitsbehörden vor Ort, der Weltgesundheitsorganisation und Ärzte ohne Grenzen.
Foto: Frank Ossenbrink/RKI