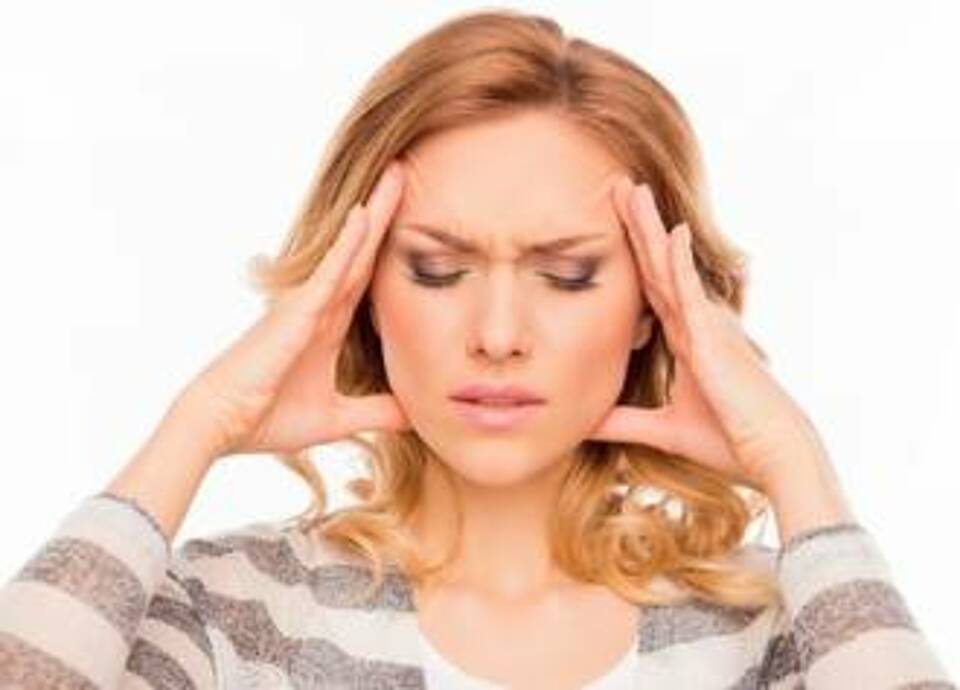
Eine Krebsdiagnose ist Stress fürs Gehirn. Dadurch kommt es zum sogenannten Chemobrain, fanden Wissenschaftler heraus
Brustkrebspatientinnen klagen nicht selten über kognitive Störungen und Konzentrationsschwäche. Der Nebel im Kopf wird Chemobrain genannt, weil man lange davon ausging, dass eine neurotoxische Wirkung der Chemotherapie der Auslöser ist. Jetzt haben Forscher eine andere Erklärung gefunden. Demnach geht das Chemobrain auf posttraumatischen Stress zurück. Dieser sei nicht mit Alltagsstress zu verwechseln, sondern greife tief in die Arbeitsweise des Gehirns ein, berichtet das Team um Dr. Kerstin Hermelink von der Ludwig Maximilians Universität München (LMU). „Eine Krebserkrankung kann als Trauma erlebt werden. Deshalb war es naheliegend, die Hypothese aufzustellen, dass kognitive Auffälligkeiten bei Krebspatientinnen eine Folge von posttraumatischer Stressbelastung sind“, sagt Hermelink.
Ein Trauma wie Krebs hinterlässt Spuren im Gehirn
In der Studie Cognicares (Cognition in Breast Cancer Patients – the Impact of Cancer-related Stress) konnten die Forscher ihre Hypothese bestätigen. Ein Jahr nach der Diagnose Brustkrebs fanden sich minimale kognitive Auffälligkeiten sowohl bei Patientinnen nach einer Chemotherapie als auch bei Patientinnen, die ohne Chemotherapie behandelt worden waren. „Wie vermutet, hingen die Auffälligkeiten mit posttraumatischem Stress zusammen“, sagt Brustkrebsexpertin Hermelink.
An der Studie nahmen 166 Frauen mit neu diagnostiziertem Brustkrebs teil. Die Kontrollgruppe bestand aus 60 gesunden Frauen. Innerhalb von zwölf Monaten wurden alle Frauen dreimal auf posttraumatische Symptomatik hin untersucht. Hierfür nutzten die Forscher klinische Interviews und neuropsychologische Verfahren. Dabei zeigte sich ein leichter, gerade noch nachweisbarer Unterschied zwischen den Krebspatientinnen und der Kontrollgruppe. Zudem machten die Patientinnen in einem der neuropsychologischen Verfahren schon vor Behandlungsbeginn und ebenso ein Jahr später mehr Fehler. „Alle diese Auffälligkeiten hingen mit der Stärke posttraumatischer Symptomatik zusammen und der Effekt der Krebserkrankung auf die Aufmerksamkeit war nicht mehr statistisch signifikant, wenn der Effekt von posttraumatischem Stress berücksichtigt wurde“, fasst Hermelink die Testergebnisse zusammen.
Chemo könnte Fingernerven minimal schädigen
Eine Auffälligkeit innerhalb der Patientengruppe gab es aber doch: Chemotherapie-Patientinnen zeigten etwas längere Reaktionszeiten in einem Test, bei dem sie klicken mussten, sobald ein Kreuz auf dem Bildschirm erschien. „Der minimale Unterschied – im Mittel 19 Millisekunden – könnte auch durch eine periphere Neuropathie, eine Schädigung der Fingernerven durch bestimmte Zytostatika, entstanden sein und nichts mit kognitiven Funktionen zu tun haben“, sagt Hermelink. Mit posttraumatischem Stress habe das nichts zu tun.
Hirn ändert seine Struktur
Was aber macht eine Krebsdiagnose mit dem Gehirn? Laut den Forschern verändert es seine Funktionsweise und auch seine Struktur ständig in Abhängigkeit von dem, was wir tun und erleben. „Es wäre sonderbar, wenn all das, was eine Krebserkrankung an Folgen für die Psyche und an Eingriffen in das Leben mit sich bringt, spurlos am Gehirn und den kognitiven Funktionen vorübergehen würde“, sagt Hermelink. .“ Insgesamt findet sie die Studienergebnisse eine gute Nachricht für Krebspatientinnen: Die Befürchtung, durch neurotoxische Wirkungen der Chemotherapie zwangsläufig eine Schädigung ihrer kognitiven Funktionen zu erleiden, sei augenscheinlich unbegründet.
Foto: © bernardbodo - Fotolia.com











