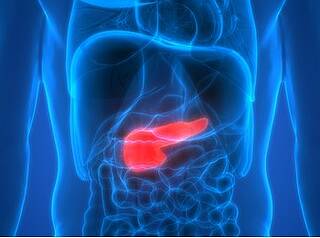Bauchspeicheldrüsenkrebs: Neue Erkenntnisse zur Tumorentstehung

Bauchspeicheldrüsenkrebs gilt als besonders gefährlich – Foto: Henrie - Fotolia
Rund 15.000 Menschen erkranken in Deutschland jedes Jahr an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Dieser Krebs ist besonders gefährlich, da er nur schwer durch Strahlen- oder Chemotherapie zu behandeln ist, früh in die Umgebung streut und oft erst spät entdeckt wird. Viele Patienten sterben daher nur wenige Monate nach der Diagnose. Warum Pankreaskrebs aber so aggressiv ist, lag lange im Dunkeln. Forscher haben sich nun auf die Spur der molekularen Veränderungen in den Krebszellen gemacht. Dabei stellten sie fest, dass ein kleines Molekül, welches Entzündungssignale in der Bauchspeicheldrüse reguliert, entscheidend an der Tumorentstehung beteiligt ist.
Entzündungsreaktion aktiviert Krebsgen
Schon früher hatten Untersuchungen an Krebszellen aus der Bauchspeicheldrüse in fast allen Fällen eine Übereinstimmung gezeigt: Ein bestimmtes Gen war mutiert, das KRAS-Onkogen. Diese Mutation tritt auch schon auf, wenn es Entzündungen oder Schäden in der Bauchspeicheldrüse gibt, die noch nicht bösartig sind. Ab wann aber eine vorgeschädigte Zelle zur Tumorzelle entartet und was genau die gefährliche Veränderung auslöst, ist im Detail bisher nicht bekannt.
Professor Jens Siveke, Gastroenterologe und Spezialist für Krebs im Verdauungstrakt, konnte zusammen mit einem Team des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München im Mausversuch zeigen, dass eine Entzündung in den sogenannten azinären Zellen, die für die Produktion von Verdauungssäften zuständig sind, eine Art Auslöser für die bösartige Veränderung darstellt. Die Entzündungsreaktion der Zellen setzt demnach zahlreiche Botenstoffe frei, die schließlich das bereits mutierte KRAS-Onkogen weiter aktivieren und die Zellentartung fördern.
Hoffnung auf neue Therapieansätze bei Bauchspeicheldrüsenkrebs
Die Arbeitsgruppe um Jens Siveke konnte dabei auch weitere Mitspieler im Krebsgeschehen identifizieren, den epidermal growth factor receptor (EGFR) sowie ein Molekül, das eine Schlüsselrolle für wichtige Wachstums- und Teilungsprozesse der Zelle spielt: RAC1. Die Mäuse hatten die typische KRAS-Mutation in den Bauchspeicheldrüsenzellen, im Versuch wurde aber der RAC1-Botenstoff bei ihnen mit molekularen Methoden gestoppt. Das überraschende Ergebnis: Fehlte RAC1 durch genetische Manipulation, wurde die Entartung der vorgeschädigten Zelle zur Tumorzelle komplett unterdrückt. RAC1 ist dabei zuständig für die Aussendung von Entzündungssignalen, die wiederum die Veränderung zur Tumorzelle durch KRAS auslösen.
„Unsere Versuche zeigen, dass Zellen tatsächlich dauerhaft dem Stress des mutierten Onkogens KRAS widerstehen können. Wir waren sehr erstaunt, dass das überhaupt geht – und es eröffnet Ansätze für ganz neue Therapieverfahren“, so Siveke. Der Mediziner betreut und behandelt viele Patienten mit Pankreaskarzinom und hofft jetzt darauf, dass er, der inzwischen am Westdeutschen Tumorzentrum der Universitätsklinikum Essen und Deutschen Krebsforschungszentrum arbeitet, mit seinem Team auch Medikamente und zielgerichtete Verfahren zur Beeinflussung von RAC1 und KRAS entwickeln kann.
Foto: © Henrie - Fotolia.com